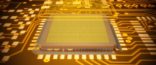Neue Erkenntnisse über die Komplexität des individuellen Musikgeschmacks
Sag‘ mir, was du hörst, und ich sag‘ dir, wer du bist! Musikgeschmack ist durchaus identitätsstiftend. Um ihn näher zu beschreiben, werden häufig Genrebegriffe zu Hilfe gezogen. Forscherinnen des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik (MPIEA) in Frankfurt am Main haben jedoch erstmals empirisch nachgewiesen, dass der persönliche Musikgeschmack mit Genres nicht ausreichend beschrieben ist. Vielmehr ermöglicht die zusätzliche Verwendung von Subgenres ein differenzierteres Verständnis der individuellen Unterschiede, wie das Team im Open-Access-Fachmagazin Frontiers in Psychology erläutert.
Die Forscherinnen befragten in einer repräsentativen Stichprobe mehr als 2.000 Personen in Deutschland zu deren Musikgeschmack. In der Auswertung fokussierten sie sich auf die Fans von fünf Genres westlicher Musik – europäische Klassik, elektronische Tanzmusik (EDM), Metal, Pop und Rock – und bezogen erstmals in einer Untersuchung systematisch auch Subgenres mit ein.
„Unsere Analysen haben ergeben, dass Menschen, die dasselbe Musikgenre mögen, durchaus unterschiedliche Geschmäcker haben können“, berichtet Anne Siebrasse, Erstautorin der Studie vom MPIEA. „Dementsprechend sind Fans bestimmter Genres auch keinesfalls als homogene Gruppen zu betrachten. Vielmehr treten auf Subgenreebene Geschmacksunterschiede innerhalb dieser Gruppen zutage, die auch mit dem Alter, dem Geschlecht, dem Bildungsniveau, dem Lebensstil oder den Persönlichkeitsmerkmalen der Menschen zusammenhängen.“
So wären Fans der Beatles und der Rolling Stones auf Genreebene eigentlich alle Rock-Fans. Sie selbst würden sich jedoch vermutlich klar voneinander abgrenzen. Um solchen Nuancierungen gerecht zu werden, entwickelte Seniorautorin Melanie Wald-Fuhrmann, Direktorin am MPIEA, einen speziellen Fragebogen. In diesem sollten die Teilnehmer:innen auch angeben, wie sehr sie die mit den untersuchten Genres verbundenen Substile mochten. Durch die systematische Erfassung der Vorlieben und Abneigungen auf Genre- und Subgenre-Ebene erhielt das Team schließlich ein differenzierteres Bild des individuellen Musikgeschmacks.
Die Auswertungen ergaben, dass innerhalb von Fangruppen sehr unterschiedliche Untergruppen zu finden sind, die sich anhand ihrer Vorlieben für bestimmte Subgenres unterscheiden. Dabei kristallisierten sich insgesamt fünf Subgruppen heraus:
„Über alle Fangruppen hinweg konnten wir jeweils drei Untergruppen ausmachen, die alle Substile eines Genres ungefähr gleich stark mochten – entweder alle sehr, durchschnittlich oder eher weniger. Zwei weitere Untergruppen differenzierten hingegen: Sie bevorzugten entweder Subgenres, die als ‚härter‘ oder anspruchsvoller beschrieben werden können, oder die eher ‚weicheren‘, dem Mainstream zuzuordnenden Subgenres“, erläutert Wald-Fuhrmann.
Bei allen untersuchten Genres wurden Subgenres, die dem Mainstream zuzuordnen sind, im Allgemeinen gegenüber anspruchsvolleren Alternativen bevorzugt. Im Bereich des Pop ergab sich allerdings ein interessantes anderes Bild, so war hier ein klarer Alterseffekt zu erkennen: Die Popmusik, die die Befragten am liebsten hörten, stammte aus dem Jahrzehnt, in dem sie etwa 20 Jahre alt waren, ein Effekt, der als „Song-Specific Age“ bekannt ist. Bestimmte soziodemografische und persönliche Variablen können demzufolge auch auf die Zugehörigkeit zu einer Fangruppe hinweisen.
Die Ergebnisse dieser Studie bieten detailliertere Erkenntnisse über den Musikgeschmack der deutschen Wohnbevölkerung als bisherige Studien zu diesem Thema. Einige Ergebnisse, wie die Identifizierung von Untergruppen innerhalb der Fangruppen, sind vermutlich übertragbar auf andere Länder und Kulturen. Andere, genrespezifische Erkenntnisse können jedoch von der Geschichte und der Rolle eines Genres innerhalb der jeweiligen Musikwelt abhängig sein.
„Wir haben in der Entwicklung von Fragebögen zur Erforschung des Musikgeschmacks einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Siebrasse. „Unser Ansatz sollte nun auf andere Genres und Regionen ausgeweitet werden. Ein weiterer Schritt könnte auch sein, diese Art der Befragung mit konkreten Klangbeispielen zu kombinieren.“
Quelle: Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik